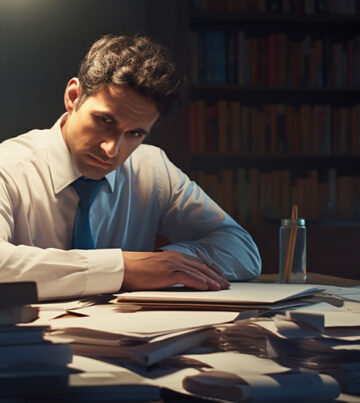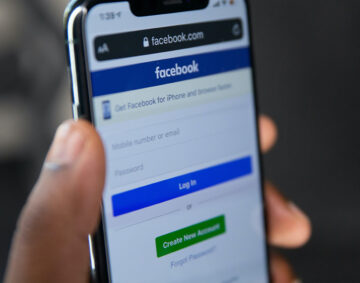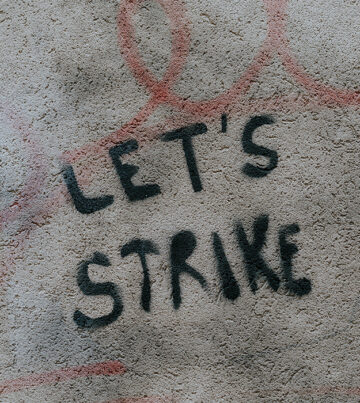Der SWP-Arbeitsrecht-Blog
Als Fachanwälte für Arbeitsrecht und Berater für Betriebsräte wissen wir, dass man sich schnell im Dschungel der vielen Gesetze, Paragraphen und vor allem Änderungen verlieren kann. Daher betrachten wir die Inhalte auf unserem SWP-Blog als eine ergänzende Dienstleistung, die auch Betriebsräten oder Arbeitnehmern, die zurzeit nicht durch unser SWP Anwalt-Team vertreten werden, helfen können, ihren rechtlichen Spielraum besser zu verstehen.